Jahresbilanz und Vorschau
Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (SMÄK) blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Mit 148.562 Besuchenden stellt das Museum einen neuen Besucherrekord auf – ein erneuter Anstieg im dritten Jahr in Folge. Neben diesem eindrucksvollen Ergebnis belegen zahlreiche innovative Projekte, Sonderausstellungen und Veranstaltungen ein aktives und vielseitiges Museumsjahr.
 © Alexander Scharf
© Alexander ScharfSonderausstellung NAGA
Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (SMÄK) präsentiert ab 18. März im Sonderausstellungssaal die Ausstellung „NAGA – Die verschüttete Königsstadt“, die bereits 2023 mit großem Besuchererfolg zu sehen war. Die Wiederaufnahme trägt dem Krieg und den aktuellen Entwicklungen im Sudan Rechnung, die eine humanitäre Katastrophe und den drohenden Verlust unschätzbaren Kulturerbes bedeuten: „Die erneute Präsentation der Ausstellung ist ein kleiner Beitrag, um auf die Dringlichkeit des Schutzes der Menschen und des kulturellen Erbes im Krisengebiet aufmerksam zu machen“, erklärt Dr. Arnulf Schlüter, Direktor des Ägyptischen Museums.
 © SMÄK; Foto Roy Hessing
© SMÄK; Foto Roy HessingSonderausstellung Corinthium Aes
Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (SMÄK) präsentiert ab 18. März 2025 die Sonderausstellung „Corinthium Aes – Das Geheimnis des schwarzen Kupfers“.
Im neu gestalteten Raum für wechselnde Kabinettausstellungen, dem „Cubus“, widmet sie sich dem geheimnisvollen „korinthischen Erz“, aus dem in der Antike wertvolle Objekte hergestellt wurden.
 © SMÄK, Foto: R. Hessing
© SMÄK, Foto: R. HessingKontakt für Presseanfragen
Anfragen richten Sie bitte an (extern):
Kulturmarketing München
Dr. Carsten Gerhard
cg@kulturmarketing-gerhard.de
089/244 11 64 80
www.kulturmarketing-gerhard.de
Nutzungsrechte
Die Nutzung der Bilder, die hier zum Download bereit stehen, ist grundsätzlich nur erlaubt zu Zwecken aktueller Berichterstattung über das Museum in Publikums- oder Fachmedien unter Angabe der jeweiligen Fotocredits.
Sämtliche andere Nutzungsarten sind kostenpflichtig und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Museums.


 © SMÄK, Foto: Claus Rammel
© SMÄK, Foto: Claus Rammel
 ©
©  ©
©  ©
©  ©
©  ©
©  ©
©  ©
©  ©
©  ©
©  ©
© 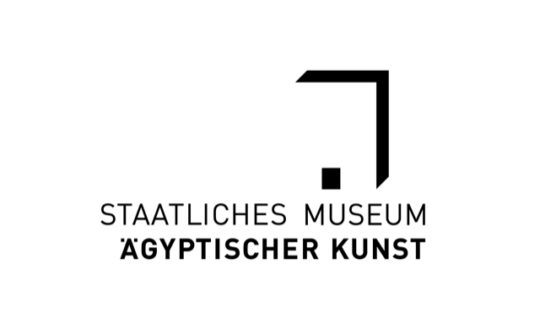 ©
©  ©
©